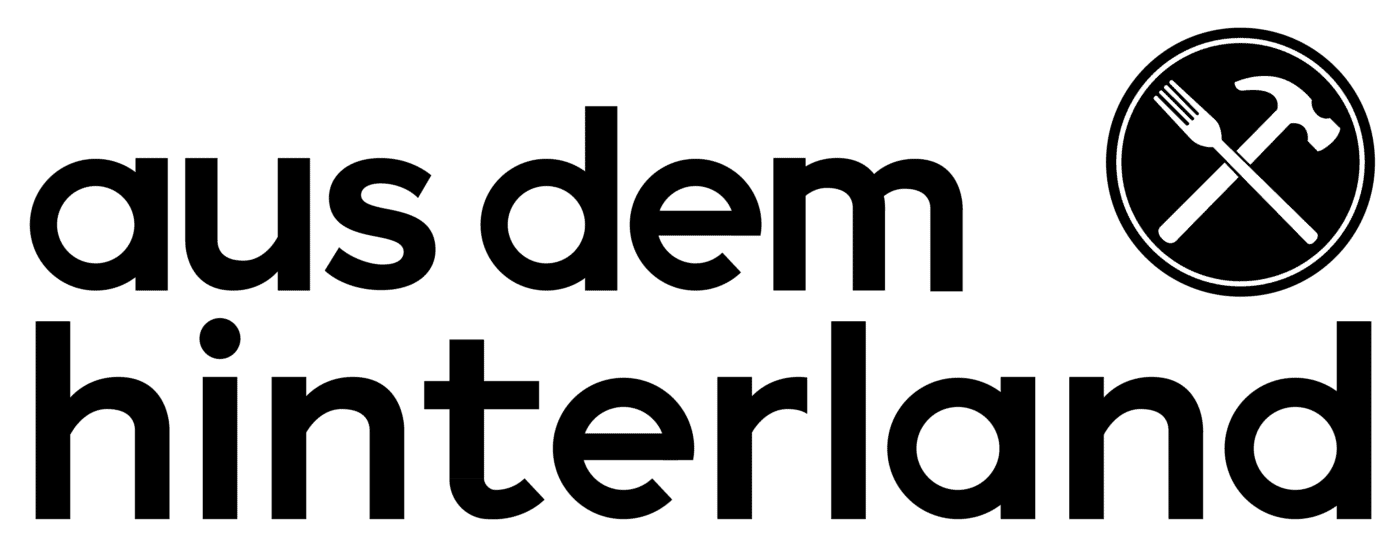Reportagen
Das Ei, Hommage an das Symbol des Lebens

Philosophen mögen sich in Phrasen winden, doch den Volksmund wird man nie bei einem geistigen Eiertanz überraschen. Er formuliert auch dann faxenlos seine Meinung, wenn es um das Symbol des Lebens geht: „Ob Mensch, ob Tier, es bleibt dabei, ihr Ursprung ist ein kleines Ei.“ Somit wäre die uralte Frage, was zuerst da war, die Henne oder das Ei, gelöst.
Hühner selber kennen keine Ideologie. Die meisten weißen Eier stammen von weißen Hennen, die meisten braunen von braunen, doch gibt es auch braun legende weiße Rassen und umgekehrt. Mal legen sie das Ei mit dem stumpfen Pol voran, dann mit dem spitzen – wie es ihnen gefällt.
Jedenfalls ist Ostern ohne Ei undenkbar. Es gilt als Symbol des Lebens und ist so vollkommen in seiner Form, dass jeder Designer davon träumt, es vor dem großen Stylisten namens Natur geschaffen zu haben. Zwar hat die Ernährungswissenschaft mit dem Hinweis auf Cholesterin einen Schatten auf Eierspeisen geworfen. Zuviel Ei sei ungesund. Aber bitte, was ist zuviel? Bismarck hat bis ins hohe Alter hinein Eier elegant mit einem Hornlöffelchen aufgeklopft. Madame Pompadour und Napoleon liebten Eier, ebenso der Dichter Jean Paul, der Maler Menzel und der Komponist Händel. Wer seinen Körper kennt, wird schon wissen, was dem frommt, und eine kleine österliche Eierorgie hat noch niemandem geschadet.
Im finnischen Nationalepos „Kalevala“ legt der Gott der Lüfte in Gestalt einer Ente auf das aus dem Ur-Ozean herausragende Knie einer schlafenden Meeresgöttin sieben Welteneier aus Gold und Eisen, aber durch eine unachtsame Bewegung der Wassermutter brechen die Eier – und daraus entstand das Universum. So einfach war das. Die alten Germanen sahen im Ei das Göttliche und das Geheimnis der Fruchtbarkeit. Also aßen sie fleißig Eier, bevor sie in die Schlacht zogen oder zur Geliebten gingen. Später kamen die Eier ins Gerede; man dachte, der Teufel stecke darin sowie der Fluch der Fleischeslust, und Mönche gab es, die predigten, Hexen bedienten sich der Eier als Zaubermittel, indem sie in die Spitze der Innenseite eines Eies den Namen des Opfers schrieben.
Leider wird dem Ei als kulinarischem Solo nur selten die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. Omelettes geraten meist zu trocken, Spiegeleier zu hartrandig. Letzteres ist perfekt, wenn das Weiße wie das Gelbe die gleiche Konsistenz haben und der Dotter mit einer leicht irisierenden Haut, dem berühmten Spiegel, überzogen ist. Dazu bedarf es eines feuerfesten Geschirrs von kleinem Durchmesser – damit sich das Eiweiß nicht zu weit ausdehnt –, in dem bei kleiner Hitze etwas Butter zerlassen wird. Die Eier hineinschlagen und das Pfännchen in die Bratröhre schieben, wo bei leicht stärkerer Ober- als Unterhitze die Spiegeleier in drei bis vier Minuten wohl geraten.
Wie beim Spiegelei glauben auch beim Rührei viele, das habe nichts mit Kochkunst zu tun. Welch ein Irrtum! Das erste Gebot heißt: kleine Hitze! Das zweite lautet: Butter, Butter, Butter! Die Eier in eine schwere Pfanne schlagen, salzen, pfeffern, zerquirlen und bei geringer Hitze (am besten: im Wasserbad) so lange mit dem Schneebesen rühren, bis der Brei die ersten Anzeichen von Festwerden zeigt; ein paar Spritzer Sprudelwasser begünstigen übrigens das Luftige. Nun in kleine Stückchen geschnittene Butter hineinrühren, immer wieder, bis das Gericht dickflüssig, aber noch nicht eigentlich gestockt ist und golden glänzt. Ein Rührei darf keine Haut haben, es muss aussehen wie ein federleichtes, schaumiges Wölkchen.
Ob ein Ei frisch ist, erkennt man übrigens daran, dass es, in eine Schüssel voll Wasser gelegt, am Boden liegen bleibt. Ältere Eier richten sich auf oder schwimmen gar. Der Grund ist einfach: Durch die Schale verdunstet Feuchtigkeit und es bildet sich eine immer größer werdende Luftkammer. Ein mittelgroßes Ei enthält nebst Wasser, Fett, Mineralien, Lezithin und Vitaminen vor allem im Dotter etwa sieben Gramm hochwertige Proteine – und das alles unabhängig von der Farbe der Schale.
Schließlich sind „Eier eine Säule der Küche“, wie es im Appetitlexikon von Habs & Rosner aus dem Jahre 1894 heißt. Ähnlich hat es Grimod de la Reyniere gesehen, der erste Gastro-Kritiker, der vor 200 Jahren meinte, nehme man den Köchen die Eier weg, würde deren Kunst elend zusammenbrechen. So ist es: Eier geben Mehlspeisen die goldene Farbe, Saucen den Halt und Aufläufen deren stolze Höhe. Um zu ermessen, was sich Köche alles mit Eiern ausgedacht haben, muss man in Hering’s „Lexikon der Küche“ nachschauen: rund 600 Ei-Variationen sind dort penibel verzeichne wie beispielsweise Eiernockerl à la Rottenhöfer.
Wie sich die Zeiten auch beim Thema Ei ändern, belegt ein Blick in die Literatur. Heute unterscheiden Feinschmecker grob die Eier aus industriell strukturierter Massentierhaltung von denen, die sogenannte „glückliche Hühner“ unter dem Patronat eines Hahns im kleinbäuerlichen Hof frei umherlaufend und scharrend le- gen. Letztere sind aromatischer, duftiger.
Weit differenzierter hat sich Guy de Maupassant um 1900 mit der Qualitätsfrage auseinander gesetzt: „Wie selten sind doch heutzutage wirklich gute Eier, mit rötlichen Dottern und dem richtigem Aroma. Ganz besonders penibel bin ich bei der Fütterung meiner Hühner. Was das Tier an Futter zu sich genommen hat, die Quintessenz seiner gesamten Nahrung – all das muß man mitschmecken können. Wieviel besser würden die Menschen essen, wenn sie auf diesen Punkt mehr achten würden.“
Eher scheinen die Menschen am Beginn des 21. Jahrhunderts aufs Zeremonielle zu schauen, nämlich darauf, wie einer das Frühstücksei öffnet. Klopft er es mit dem kleinen Löffel auf, gilt er nach dem kleinen Einmaleins des Innenlebens als feinfühlig, als zaghaft gar; köpft er es messerscharf, wird er entweder als brutaler Grobian oder dynamischer Typ angesehen. Hölderlin wird demnach das Ei wohl aufgeklopft, Napoleon hingegen geköpft haben.
Wie auch immer: Ein Fest fürs Auge ist ein luftig geratenes Ei-Soufflé, apart serviert in der ausgehöhlten Eierschale. Sinnliches Vergnügen bereitet ein mit Geflügellebermus gefülltes „Rouener Omelette“, hinreißend schmecken Spiegeleier nach „Nizzaer Art“ auf geschmolzenen Tomaten, vermischt mit Estragon sowie Sardellenstreifen. Delikat ist ein Spiegelei auf Spinat mit weißen Trüffeln (ersatzweise parfümiert mit Trüffelöl). Schwarze Trüffel vervollkommnen Rühreier. Raffinesse haben wächsern gekochte Siebenminuteneier, halbiert, serviert auf Kartoffelpüree mit Kresse und flankiert von einer geschmeidigen Senfsauce – oder echtem steirischem Bauernkürbiskernöl.
Dieses Ei à la Therese ist nicht so kostbar wie das „Liebestrophäe“ genannte Schmuckei des berühmten Juweliers Fabergé, das Zar Nikolaus an Ostern 1905 seiner Frau schenkte, aber es ist tausendmal leckerer. Hauptsache bei einem Ei ist nämlich, dass sich im tiefgelben Dotter so etwas wie die Erinnerung an die Sonne über dem Bauernhof spiegelt.
(FINK Magazin, Text: August F. Winkler)
 ist zertifizierter
ist zertifizierter 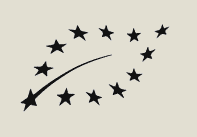 BIO-Händler und stolzes
BIO-Händler und stolzes  Slow Food-Mitglied — Tante Emma wäre stolz auf uns!
Slow Food-Mitglied — Tante Emma wäre stolz auf uns!